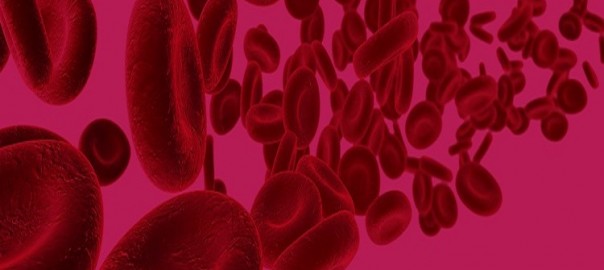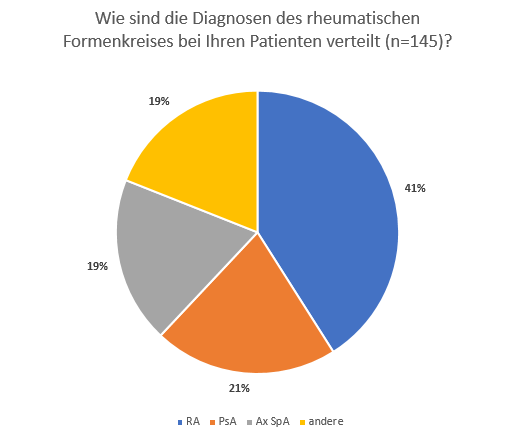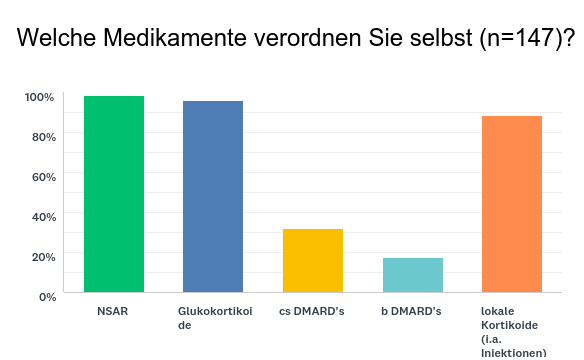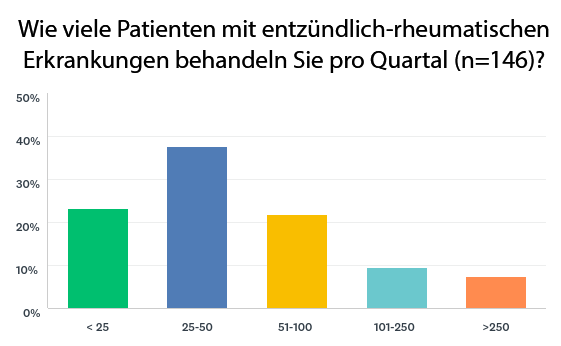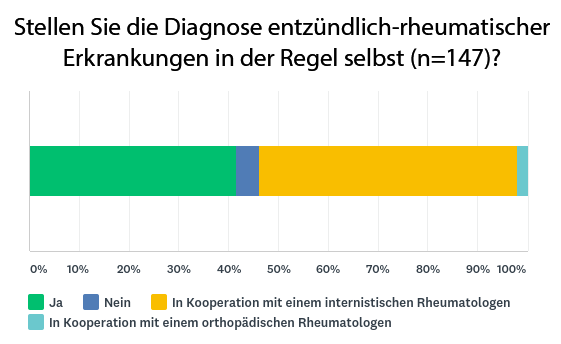Baden-Baden – Seit der europäischen Zulassung 2017 überzeugt das Biosimilar Enoxaparin BECAT® – auch durch die Preisgestaltung. Bei einem vom BVOU und der Firma ROVI ausgerichteten Symposium im Rahmen der VSOU Frühjahrstagung diskutierten renommierte Experten über die aktuellen Strategien zur Thromboseprophylaxe und den Stellenwert von niedermolekularen Heparinen (NMH) und deren Biosimilars bei orthopädischen Operationen.
Biosimilar – was heißt das?
Der Nachweis der Biosimilarität eines niedermolekularen Heparins (NMH) zum Referenzprodukt beruht auf der Vergleichbarkeit der physikochemischen Merkmale sowie vergleichbaren pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Profilen beider Produkte, so beschreiben es die Zulassungsbehörden.
Wie Prof. Dr. Theodor Dingermann, Institut für pharmazeutische Biologie an der Goethe-Universität in Frankfurt, beim Symposium erläuterte, wurde die Bioäquivalenz von Enoxaparin BECAT® zum Referenzprodukt (Clexane®) in allen von der EMA-Richtlinie (1) geforderten pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Parametern belegt.
Enoxaparin BECAT® wird in den Produktionsstätten von ROVI, einem spanischen Pharmaunternehmen, das seit über 35 Jahren auf Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von niedermolekularen Heparinen spezialisiert ist, in Granada und Madrid hergestellt. Diese sind GMP-zertifiziert und wurden von der FDA geprüft.
Dingermann präsentierte in Baden-Baden die zulassungsrelevante Bioäquivalenzstudie von González (2) und Kollegen: „Wir haben es hier immer mit eher kleinen Studien zu tun, da das Prozedere bei Biosimilars rein konfirmatorisch ist“. Insgesamt nahmen 33 männliche und 13 weibliche Probanden im Alter zwischen 18 und 44 Jahren und einem BMI zwischen 19,0 und 31,1 an der Studie teil. Sie bekamen entweder das Enoxaparin-Natrium von ROVI oder den Originator (Clexane®) subkutan appliziert. „Die Biosimilarität ist gezeigt, wenn das 95%-Konfidenzinterwall innerhalb des Standardbereichs der Bioäquivalenz liegt, d.h., 80%-125%“, erläuterte Dingermann die Analysen. „Enoxaparin BECAT® ist zum Referenzprodukt in allen primären (Anti-Xa- und Anti-IIa-Aktivität) und sekundären (Verhältnis von Anti-Xa zu Anti-IIa- und TFPI-Aktivität) PK/PD-Parametern äquivalent“.
Biosimilars – die wirtschaftliche Alternative zum Originator
Da die Wirksamkeit und Sicherheit des Originalpräparats Clexane® für viele Indikationen nachgewiesen ist, wird Enoxaparin-Natrium in relevanten Leitlinien der Fachgesellschaften empfohlen und in der täglichen Praxis verwendet.
Das Biosimilar Enoxaparin Becat® (3) wird seit 2017 zur Prophylaxe und Therapie von venösen Thromboembolien (VTE) bei Erwachsenen kostengünstig eingesetzt. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft empfiehlt sowohl bei der Erstverordnung von Biosimilars als auch bei der Folgeverordnung zur Fortsetzung der Therapie jeweils die wirtschaftlichere Verordnungsalternative unter der Voraussetzung auszuwählen, dass eine praxistaugliche Einzeldosisstärke und eine für die Behandlung geeignete Darreichungsform verfügbar ist sowie eine Zulassung für die zu behandelnde Erkrankung vorliegt (4). Dies trifft auf Enoxaparin-BECAT® zu, denn zuzahlungsfreie Packungen sind in allen Dosierungen erhältlich und bieten bis zu 10 € Ersparnis pro Packung. Mittlerweile unterhält ROVI mit bundesweit über 100 Krankenkassen Rabattverträge nach §130a Abs. 8 SGB V.
Perioperative Thromboseprophylaxe und Bridging – ein Update
Dr. Siamak Pourhassan, Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie in einer Gemeinschaftspraxis in Oberhausen, fasste noch einmal das Wichtigste der aktuellen S3-Leitlinie (5) zur Prophylaxe der VTE zusammen. Die jährliche Inzidenz symptomatischer tiefer Beinvenenthrombosen (TVT) liegt in der Allgemeinbevölkerung bei 90 bis 130 auf 100.000 Einwohner, sie steigt jedoch im Alter um den Faktor 10.
„Für endoprothetische Hüft- und Kniegelenksoperationen ohne TVT-Prophylaxe wurde eine Inzidenz von > 50% an Thrombosen beschrieben. Mehr als die Hälfte der Thrombosen ereigneten sich im Unterschenkel-Bereich und waren teils klinisch unauffällig“, so Pourhassan.
Bei allen Patienten mit operativen Eingriffen, Verletzungen oder akuten Erkrankungen soll gemäß der Leitlinie das Risiko venöser Thromboembolien bedacht werden. Die Indikationsstellung zur VTE-Prophylaxe soll stets individuell und risikoadaptiert erfolgen. Hierbei wird das Risiko in drei Grade unterteilt:
• Gering (z.B. kleine operative Eingriffe)
• Mittel (länger dauernde Operationen, gelenkübergreifende Immobilisation der unteren Extremität im Hartverband etc.) und
• Hoch (wie größere Eingriffe an Wirbelsäule, Becken, Hüft- oder Kniegelenk).
Basismaßnahmen alleine oder zusätzlich medikamentöse VTE-Prophylaxe?
Für Patienten mit niedrigem VTE-Risiko sollten stets Basismaßnahmen wie Frühmobilisation, Bewegungsübungen, Anleitung zu Eigenübungen zur Anwendung kommen, so die Empfehlung. Bei Patienten mit mittlerem und hohem VTE-Risiko ist zusätzlich eine medikamentöse VTE-Prophylaxe indiziert. Pourhassan griff sich einige – für Orthopäden relevante – Beispiele aus der S3-Leitlinie heraus:
• Nach Operationen an der oberen Extremität sollte in der Regel keine VTE-Prophylaxe erfolgen, eine Ausnahme bildet die Implantation von Schultergelenkprothesen –nach Trauma, bei Karzinomerkrankungen oder bei älteren Patienten bzw. wenn zusätzlich dispositionelle Faktoren mit hohem Risiko vorliegen.
• Patienten mit großen orthopädischen oder unfallchirurgischen Eingriffen an der Hüfte sollen eine medikamentöse VTE-Prophylaxe erhalten.
• Bei elektivem Kniegelenkersatz soll die medikamentöse VTE-Prophylaxe 11 bis 14 Tage durchgeführt werden.
• Patienten mit operativ versorgten Verletzungen der Knochen und/oder mit fixierenden Verbänden an der unteren Extremität sollten eine medikamentöse VTE-Prophylaxe mit NMH durchführen. „Studien zum Effekt der Prophylaxe mit NMH zeigten eine Inzidenz von 10 bis 20% für Hüft- und 20 bis 30% für Knie-Endoprothesen“, erklärte Pourhassan.
Bridging mit Enoxaparin
Pourhassan stellte zur Diskussion, wie man in der täglichen Praxis mit denjenigen Patienten umgeht, die bereits antikoaguliert sind „Diese Patienten sehen wir nämlich in der täglichen Praxis häufig“. Er stellte in seinem Vortrag dar, dass das Thema Bridging ein Dauerthema der letzten Jahre ist und zeigte die Neuerungen auf. (6) Wie er ausführte, muss bei jedem Patienten die Antikoagulation bei einem operativen Eingriff individuell danach ausgerichtet werden, welche Grunderkrankung vorliegt und ob der Patient Phenprocoumon erhält („marcumarisiert ist“), direkte orale Antikoagulantien (DOAKs) und/oder täglich ASS100 einnimmt.
In Deutschland bietet das „Positionspapier zur Unterbrechung antithrombotischer Behandlung bei kardialen Erkrankungen“ (7) eine gute Entscheidungshilfe für eine individuelle Therapieplanung:
• Bei hohem thromboembolischem Risiko sollte bevorzugt niedermolekulares Heparin s.c. in therapeutischer Dosis eingesetzt werden.
• Bei moderatem thromboembolischem Risiko kann NMH in therapeutischer Dosis oder in Abhängigkeit vom Blutungsrisiko in Halbdosis oder in Thromboembolieprophylaxe-Dosis eingesetzt werden.
• Bei niedrigem thromboembolischem Risiko kann niedrig dosiertes NMH s.c. gegeben werden.
Laut Pourhassan stehen für das Bridging die Optionen keine Prophylaxe, prophylaktische, halbtherapeutische und therapeutische Dosen zur Verfügung.
VKA, DOAC, ASS – wie geht man vor?
Bei Patienten, die Vitamin-K-Antagonisten (VKA) einnehmen, muss eine Unterbrechung gut begründet sein. Die kürzlich veröffentlichte BRIDGE-Studie8 zeigte, dass ein Bridging bei Patienten mit Vorhofflimmern keine Thromboembolien verhinderte (0,3-0,4%), sondern mit einer Zunahme der schweren (3,2% vs. 1,3%, p = 0,005) und leichten Blutungen (20,9% vs. 12%, p = 0,001) verbunden war. „Allerdings ist diese Studie nicht wirklich mit den Gegebenheiten in Deutschland vergleichbar, da sie mit Warfarin durchgeführt wurde“, kommentierte Pourhassan. Dennoch sei Vorsicht geboten.
Beim Absetzen von VKA müssen Hochrisikopatienten eine therapeutische Dosis bekommen, hierzu zählen alle Patienten mit Herzklappen, alle Patienten mit VHF und stattgehabter Embolie, Patienten die in den letzten 3 Monaten eine TVT oder Lungenembolie durchlebten sowie Patienten mit komplexer Thrombophilie. „Alle anderen Patienten, bei denen VKA abgesetzt werden, bekommen entweder nichts oder eine prophylaktische Dosis“, so die Empfehlungen.
„Bei den direkten oralen Antikoagulantien (DOAK) ist aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeit präoperativ keine Umstellung indiziert, allerdings haben wir hier das Problem, dass ein postoperatives Bridging notwendig werden könnte,“ fasste Pourhassan zusammen. „Denn Sie haben keine Möglichkeit der postoperativen Dosisanpassung und der VTE-Prophylaxe bei DOACs“. Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban sollten 48 Stunden vorher abgesetzt werden, Dabigatran abhängig von den Nierenwerten des Patienten auch früher, bis zu 96 Stunden.
Postoperativ sollte die Therapie sobald wie möglich wieder begonnen werden, bei größeren Eingriffen ist die Gabe von NMH wie Enoxaparin BECAT® empfehlenswert. „Das routinemäßige Absetzen von Aspirin/ASS 7 bis 10 Tage vor der Operation bei Patienten, die es zur Sekundärprävention von KHK, zerebralen Ischämien oder pAVK erhalten, ist nicht nur unberechtigt, sondern erhöht wahrscheinlich das thromboembolische Risiko aufgrund des beschriebenen Aspirin-Absetz-Syndroms deutlich, so die Auswertung aktueller Studien“, so Pourhassan abschließend in Baden-Baden.
Quelle: ROVI
Literatur:
1 Committee for Medicinal products for Human (CHMP) Guideline on non-clinical and clinical development of similar biological medicinal products containing low-molecular-weight-heparins. EMEA/CHMP/BMWP/ 118264/2007 Rev. 1, 10 November 2016. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing-low_en.pdf, Aufgerufen am 29.05.2019
2 Martínez González J et al. Drug Design, Drug Des Devel Ther. 2018;12:575-582
3 Fachinformation Enoxaparin BECAT®, Stand März 2018
4 Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft: Empfehlungen der AkdÄ zur Behandlung mit Biosimilars https://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/LF/PDF/Biosimilars-KF.pdf. Aufgerufen am 11. Mai 2019
5 S3-Leitlinie Prophylaxe der venösen Thromboembolie (VTE) 2. komplett überarbeitete Auflage, Stand: 15.10.2015. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/003-001l_S3_VTE-Prophylaxe_2015-12.pdf. Aufgerufen am 29.05.2019
6 Rechenmacher SJ et al. J Am Coll Cardiol.2015;6:1392-403.
7 Hoffmeister HM et al. Kardiologe 2010, 4:365–374
8 Douketis JD et al. N Engl J Med 2015;373:823-33