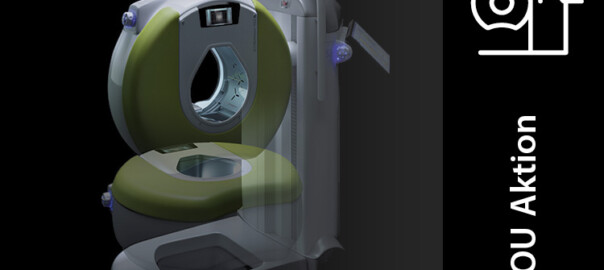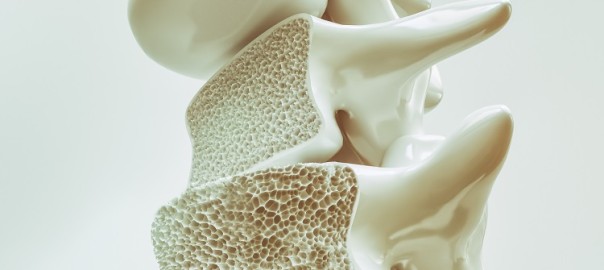Enttäuscht zeigt sich die Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen e.V. (DGIV) von den Ergebnissen des Koalitionsvertrages von Union und SPD. „Von den gleich zu Beginn des Gesundheits- und Pflegekapitels versprochenen‚ tiefgreifenden strukturellen Reformen‘ findet sich leider auf den weiteren Seiten kaum etwas wieder. Im Wesentlichen formulieren die entsprechenden Abschnitte stattdessen ein ideenloses Weiter wie bisher“, so der DGIV-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel.
Von einer entschlossenen Überwindung der Sektorengrenzen sei ebenso wenig zu sehen, wie von einer wirkungsvollen Verkammerung der Professionen. Dass schon der Ansatz der Autoren falsch sei, zeige das gewissenhafte und streng sektoral getrennte Abarbeiten der einzelnen Versorgungsbereiche, so Nagel. „Wie soll eine Versorgungsvision sich bilden, wenn die Ideen dazu akribisch in die Abschnitte ‚Ambulante Versorgung‘, ‚Apotheken‘, Krankenhauslandschaft‘ etc. unterteilt sind?“ Hier führe sich das Versprechen der ersten Textzeilen schon auf den ersten Blick ad absurdum.
Von den eigentlichen Notwendigkeiten für tiefgreifende strukturelle Veränderungen finde sich dagegen im Text kein Wort. „Der tatsächliche Versorgungsbedarf folgt nun mal nicht einer kameralistisch getrennten Abrechnungslogik, wie sie unser SGB V bis heute bestimmt und wie sie von den Autoren des Koalitionsvertrages artig abgearbeitet wird“, so die Analyse des DGIV-Vorstandsvorsitzenden. Vielmehr müsse den Akteuren die Freiheit gegeben werden, gemeinsam zu angemessenen und patientenorientierten Versorgungslösungen in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen zu kommen. „Dass im Gesundheits-Kapitel des Koalitionsvertrages das Wort „Region“ nicht ein einziges Mal fällt, ist ein Ausdruck dieser bundespolitischen Hilflosigkeit, die das Thema Gesundheit eher als Verwaltungsakt aus Berlin interpretiert, als sich an den tatsächlich zu gestaltenden Versorgungsrealitäten vor Ort zu orientieren“.
„Unsere Hoffnung bleibt, dass das Gesundheitsministerium unter neuer Führung mehr Mut an den Tag legt, als es diese ideen- und visionslosen Zeilen des Koalitionsvertrags befürchten lassen“, so Nagel. „Unsere Hand jedenfalls ist ausgestreckt, um gemeinsam mit den politischen Akteuren ein tatsächlich intersektorales, interdisziplinäres und interprofessionelles Gesundheitssystem der Zukunft zu gestalten. Was wir uns jedenfalls nicht länger leisten können, sind weitere verschwendete Jahre, die sich an einem Krankheitsverwaltungs-System von vorgestern orientieren“, lautet die grundsätzliche Kritik des DGIV-Vorstandsvorsitzenden.
Quelle: DGIV e.V.