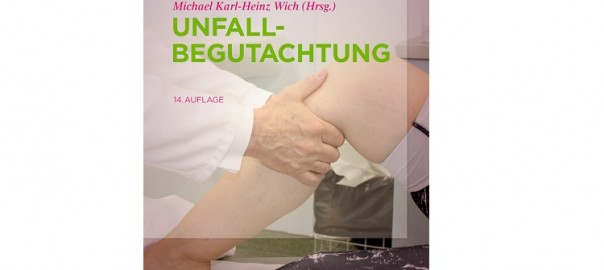Düsseldorf – Es wäre beschönigend, die Stimmung vieler Teilnehmer aus dem Krankenhausmanagement bei der heutigen Eröffnung der Medica und des 42. Deutschen Krankenhaustags in Düsseldorf als verärgert zu bezeichnen. Es herrscht Empörung – Empörung über die jüngsten Entscheidungen der Regierungskoalition zum Krankenhausbereich. Das MDK-Reformgesetzt – im Entwurf noch eine wirksame Reaktion auf die Geldschneiderei der Krankenkassen – war kurz vor der Abstimmung im Bundestag in sein Gegenteil verkehrt worden. Das hat das Fass des Erträglichen bei vielen zum Überlaufen gebracht. „Es reicht!“ heißt es auf einem großen Plakat des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD).
Das brachte auch VKD-Präsident Dr. Josef Düllings in der Eröffnungsveranstaltung sowie in der Pressekonferenz der Gesellschaft Deutscher Krankenhaustag zum Ausdruck. Warum, so fragte er, müssten aktuell so viele Krankenhäuser Insolvenz anmelden? Warum gebe es inzwischen einen geradezu extremen Pflegekräftemangel, den der Gesetzgeber doch eigentlich abstellen wollte? Warum gehe es mit der Digitalisierung nicht voran, obwohl sie doch seit vielen Jahren immer wieder von der Politik als ein wesentlicher Zukunftsbaustein thematisiert werde? Und warum würden viele der von der Politik erwarteten positiven Folgen von Gesetzen und Regelungen der letzten Jahre nicht eintreten?“
„Die wesentlichen Probleme wurden nie gelöst, sondern über die Jahre immer weiter mitgeschleppt und damit verschärft“, so seine Antwort.
Bei den Ländern sei die gesetzliche Förderpflicht zur Förderflucht geworden. Die Förderquote der Krankenhäuser, Anfang der neunziger Jahre noch bei neun Prozent, sei bis heute auf unter drei Prozent reduziert worden. „Die meisten unserer Anlagegüter sind abgeschrieben, ohne jede Zukunftsperspektive“, so Dr. Düllings. Krankenkassen hätten sich zu Sparkassen entwickelt. Ihre Rücklagen seien – auch, weil sie den Krankenhäusern permanent erhebliche Mittel entzögen – weit über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserve angestiegen. Dieses Geld gehöre in die Patientenversorgung. So verstehe der VKD den Sinn einer solidarischen Versicherung. Kassenärzte und Kassenärztliche Vereinigungen würden sich auf Kosten der Krankenhäuser entlasten. „In der ambulanten Notfallversorgung verzeichnen wir seit Jahren einen millionenfachen Anstieg der Fallzahlen mit einer bundesweiten Unterfinanzierung von einer Milliarde Euro.“
Hinzu komme, so der VKD-Präsident, dass in den letzten Jahren das Finanzierungssystem der Kliniken über Fallpauschalen an eine Grenze gekommen sei. Fehlende Leistungsgerechtigkeit und Überkomplexität des Systems schadeten vielen Krankenhäusern. „So, wie es heute gilt, ist es inzwischen zu einer Gefahr für die Krankenhausversorgung geworden.“
Aus vielen kleinen und größeren ungelösten Krisen sei über die Jahre nun eine Krise des Gesamtsystems geworden, so sein Fazit. Davon seien die Krankenhäuser als Anker dieses Systems ganz besonders betroffen, weil sie zahlreiche Funktionen und Aufgaben am Patienten orientiert mitübernehmen müssten, die andere Versorger nicht leisten könnten. Dr. Düllings: „Unser Gesundheitssystem ist an einem kritischen Punkt angelangt, an dem die sichere und gewohnt gute Versorgung für die Bevölkerung auf der Kippe steht.“
Der VKD fordere angesichts dessen erneut, dass die Länder endlich ihre gesetzlichePflicht zur Investitionsförderung erfüllen und – unterstützt vom Bund – damit den notwendigen Strukturwandel ermöglichen. Hier gehe es um eine wichtige Infrastruktur für die Bevölkerung, die nicht durch Insolvenzen, sondern geplant und sinnvoll erfolgen müsse. Unabdingbar sei in diesem Zusammenhang auch ein staatliches Sonderprogramm Digitalisierung.
Die Krankenhausplanung der Länder müsse zu einer Versorgungsplanung werden, die alle Versorgungssektoren einbeziehe und auch flexible Reaktionen auf Bedingungen und Veränderungen in den jeweiligen Regionen ermögliche. Die aktuelle Bundesgesetzgebung trage dazu bei, dass Versorgungskapazitäten reduziert würden – zu Lasten aller Sektoren. Als aktuelles Beispiel nannte Dr. Düllings die zu Beginn dieses Jahres in Kraft getretenen Pflegepersonal-Untergrenzen in vier sensitiven Bereichen, die zur Schließung von Betten und ganzen Stationen geführt haben. Dennoch würden sie im nächsten Jahr auf weitere Bereiche erweitert.
Der VKD sieht die Notwendigkeit sinnvoller, proaktiver Strukturveränderungen, stellt aber klar, dass diese nicht zum Nulltarif erfolgen können, sondern dass dafür hinreichende Fördermittel notwendig sind. Die Krankenkassen müssten sich darauf besinnen, dass sie Partner und nicht Gegner der Krankenhäuser sein sollen. Die Vergütung von Leistungen zu verweigern, die im Sinne der Patienten erbracht würden und damit auch vielfach Lücken in der ambulanten Versorgung kompensierten, entspreche nicht dem gemeinsamen Auftrag.
Einen Neustart benötigt das sehr komplexe Finanzierungssystem der Krankenhäuser. Hier ist aus Sicht des Krankenhausmanagement mittelfristig ein Systemwechsel notwendig, der aber zügig vorbereitet werden müsse. Dr. Düllings: „Die Krankenhäuser sind Symptomträger eines kranken Systems. In dieser Situation brauchen wir keine gesetzgeberischen Nachbesserungen. Was wir brauchen, ist ein Ende der Unterlassungspolitik und ist der Mut, sich von inzwischen untauglich gewordenen Gesetzen, Regelungen und Instrumenten zu trennen. Aus Sicht unseres Verbandes fehlt bisher ein gemeinsamer Wille, ein gemeinsames Ziel der maßgeblich Beteiligten – ein Masterplan – dafür, wie die Gesundheitsversorgung künftig gestaltet werden und was sie für die Bevölkerung leisten soll. Wir sind an einem Punkt, an dem wir einen Weg zurück zu unseren eigentlichen Aufgaben und zu einer Verminderung der Komplexität unseres Gesundheitssystems finden müssen. Das kann nur gelingen, wenn wir tatsächlich immer die Patienten in den Mittelpunkt stellen. Ein Weiter so wie bisher geht jetzt nicht mehr“, bekräftigte er.
Der 42. Deutsche Krankenhaustag findet zeitgleich im Rahmen der weltgrößten Medizinmesse Medica vom 18. bis zum 21. November in Düsseldorf statt. Rund 1600 Teilnehmer werden sich in Vorträgen, Diskussionsrunden, und Workshops des Krankenhaustags sowie in vielen individuellen Gesprächen mit allen Facetten des Hauptthemas beschäftigen: „Krankenhäuser im Reform-Marathon“.
Quelle: VKD