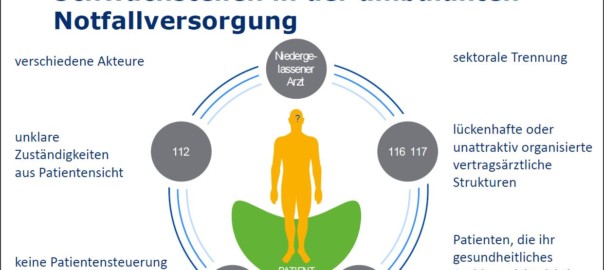Ahrensburg – „Der überwiegende Teil der von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) umgesetzten Regelungen ist durch Gesetze bestimmt, die nicht von der KVSH beeinflusst werden können“, weiß Dr. Dennis Wolter. Schon in den letzten sechs Jahren war er Mitglied der dortigen Vertreterversammlung (VV). Wenn er wiedergewählt wird, will er dazu beitragen, den ärztlichen Spielraum zu vergrößern und sich für eine angemessenere Honorierung engagieren. Wolter ist in Ahrensburg in einer Praxisgemeinschaft mit seinem Kollegen Dr. Helge Hansen niedergelassen.
7 Fragen an Dr. Dennis Wolter
BVOU.net: Warum kandidieren Sie für die Vertreterversammlung (VV)?
Wolter: Die KV steuert entscheidend den Arbeitsalltag der Kassenärzte in Schleswig-Holstein und ist damit der bestimmende Faktor unserer täglichen Arbeit. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die KV Schleswig-Holstein stark ist und die Interessen der Kassenärzte Berücksichtigung finden. Seit 2010 bin ich Mitglied der Vertreterversammlung der KVSH, habe also bereits Erfahrungen sammeln können.
BVOU.net: Wofür steht Ihre Liste?
Wolter: Ich bin kein Mitglied einer Liste, weil das in Schleswig-Holstein nicht üblich ist. Bei uns steht jeder Kandidat für sich selbst. So ist das auch bei mir. Ich bin als Orthopäde aber auch Vertreter unserer Fachgruppe O und U. Durch die eigene Erfahrung habe ich einen geschärften Blick für die Sorgen und Nöte der Kollegen und werde daran arbeiten, unsere Situation zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit dem Landesvorsitzenden des BVOU, Dr. Christian Hauschild, funktioniert sehr gut. Wir informieren uns gegenseitig und stimmen uns bei anstehenden Entscheidungen ab.
BVOU.net: Wofür wollen Sie sich engagieren, wenn Sie gewählt werden?
Wolter: Die KVSH wie die gesamte Selbstverwaltung wird vom Gesetzgeber zunehmend seinen politischen Zielen unterworfen. Leider hat das zu häufig nichts mit einer Verbesserung der Versorgung der Patienten zu tun und entspricht zudem eher selten den Wünschen der Ärzte. Der überwiegende Teil der von der KVSH umgesetzten Regelungen ist durch Gesetze bestimmt, die nicht von der KVSH beeinflusst werden können. Das ist frustrierend. Ich will dafür sorgen, dass der Einfluss der Ärzte auf die Entscheidungen wieder größer wird. Dazu ist eine starke und einige KVSH erforderlich.
Ein weiteres wichtiges Anliegen von mir: Der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) als Grundlage der Abrechnung ist derzeit nicht in der Lage, die Untersuchungen und Behandlungen in einer Praxis angemessen abzubilden. Gesetzgeberische Maßnahmen sowie Honorarverteilungs- und EBM-Maßnahmen haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten am Ende eines langen Arbeitstages nicht wissen, was sie für ihre Arbeit erhalten. Notwendig ist die Vergütung von Einzelleistungen neben pauschalierten Vergütungsformen, die das jeweils arztgruppenspezifische Leistungsspektrum abbilden. Für diese Leistungen muss es feste und kostendeckende Preise geben, die jährlich an die wirkliche Kostenentwicklung angepasst werden.
Was mir auch noch wichtig ist: Für die Vertragsärzte stellt das Regressrisiko eine massive Bedrohung dar. Allein schon die Stellung eines Prüfantrags durch die Krankenkassen führt zu einem nicht hinnehmbaren Arbeitsaufwand und einer massiven Verunsicherung, selbst wenn dann gar kein Regress festgesetzt wird. Die Gefahr eines Regresses stellt auch eine erhebliche Hemmschwelle für junge Ärzte dar, sich für die ambulante Versorgung zu entscheiden. Die Richtgrößenprüfungen mit ihren Regressen müssen daher abgeschafft werden.
BVOU.net: Welches Versorgungsthema wollen Sie dann vor allem vorantreiben?
Wolter: Erstens die Beibehaltung der hohen Qualität der Behandlung unserer Patienten durch in ihrer Therapieentscheidung unabhängige und freiberuflich tätige Ärztinnen und Ärzte. Zweitens die Optimierung der Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Vertragsärzte und die Förderung von vernetzen Strukturen.
Drittens der Einsatz dafür, dass wir uns in unserer täglichen Arbeit auf die ärztliche Tätigkeit konzentrieren können. Für alles andere müssen Lösungen gefunden werden. Und viertens die Steuerung der Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen: Die Patienten sollten in Zukunft mehr Verantwortung tragen für ihr Verhalten in Bezug auf die Inanspruchnahme von Leistungen und für ein gesundheitsbewusstes Verhalten.
BVOU.net: Und welches Honorarthema wollen Sie vorantreiben?
Wolter: Da erscheinen mir drei Themenbereiche wichtig: Wir brauchen zum einen eine leistungsgerechte und transparente Vergütung aller von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten erbrachten Leistungen. Die Verpflichtung zur unbegrenzten Abgabe von Leistungen bei weiterbestehenden Budgets ist nicht akzeptabel. Zum anderen müssen alle Leistungen, die über die Kriterien wirtschaftlich, ausreichend, notwendig und zweckmäßig (kurz: WANZ) hinausgehen, extra vergütet werden. Ich denke da an qualitativ besonders „gute” Leistungen, quasi Schulnote 2, im Vergleich zu „ausreichenden“ Leistungen, also sozusagen Schulnote 4.
Und schließlich müssen die Krankenkassen einsehen, dass es Leistungen gibt (Stichwort: Individuelle Gesundheitsleistungen), die nicht die WANZ-Kriterien erfüllen und trotzdem sinnvolle und nutzenbringende Angebote für Patienten sind. Es gibt sehr gute Kriterien zur Erbringung dieser Leistungen. Die Krankenkassen müssen diesbezüglich ihre Blockadehaltung aufgeben.
BVOU.net: Wie wollen Sie es schaffen, Zeit für die Arbeit in der VV zu erübrigen?
Wolter: Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich diese Zeit auch in einer nächsten Wahlperiode aufbringen kann. Die Tätigkeit als Abgeordneter kostet ohne Zweifel Zeit, die ich mir dafür aber gerne nehme. Bisher hat das nicht zu einer Vernachlässigung von Familie oder Freunden geführt.
BVOU.net: Wie motivieren Sie sich, wenn Sie einmal gar keine Lust auf Berufspolitik haben?
Wolter: Mir ist bisher die Lust nicht ausgegangen. Wenn das so wäre, würde ich nicht wieder kandidieren. Ich habe das Gefühl, dass sich die Berufspolitik aus der Praxis eines Vertragsarztes nicht heraushalten lässt. Es gibt aber Tage, da sind andere Dinge wichtiger. Dann bleibt der Computer ausgeschaltet und das Mobiltelefon still. Es ist gesund, sich Raum zur Regeneration zu schaffen, mit der Familie etwas zu unternehmen, ein Konzert oder das Theater zu besuchen oder Sport zu treiben. Ich versuche, die Balance zu halten.
(Das Interview führte Sabine Rieser. Der BVOU veröffentlicht zurzeit regelmäßig Interviews mit Orthopäden und Unfallchirurgen, die für die KV-Wahlen kandidieren.)
Weiterführende Informationen:
KV-Wahlen 2016: Die Termine für ganz Deutschland
Weitere Interviews:
KV-Wahlen 2016: Die Kandidaten aus O und U im Gespräch