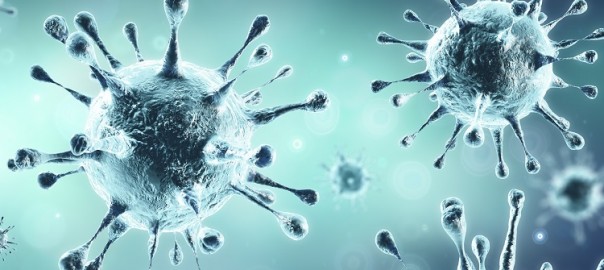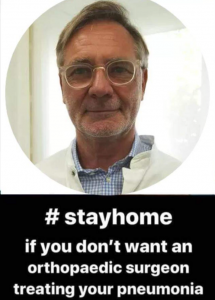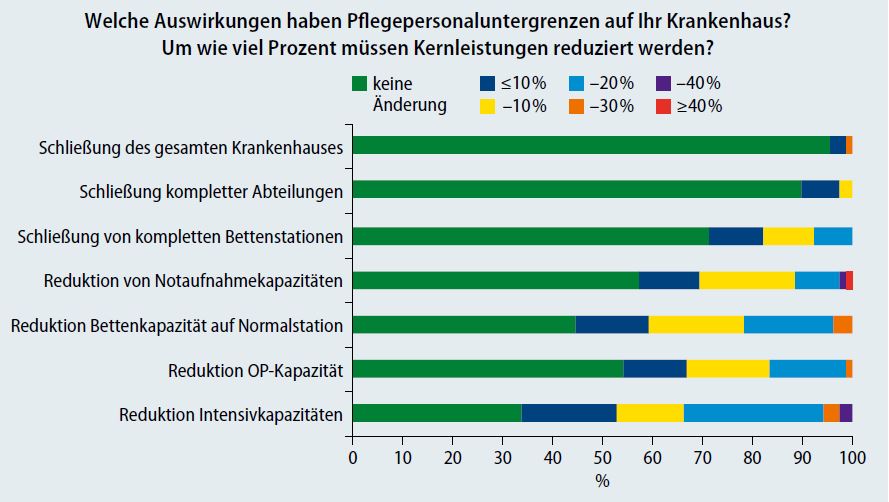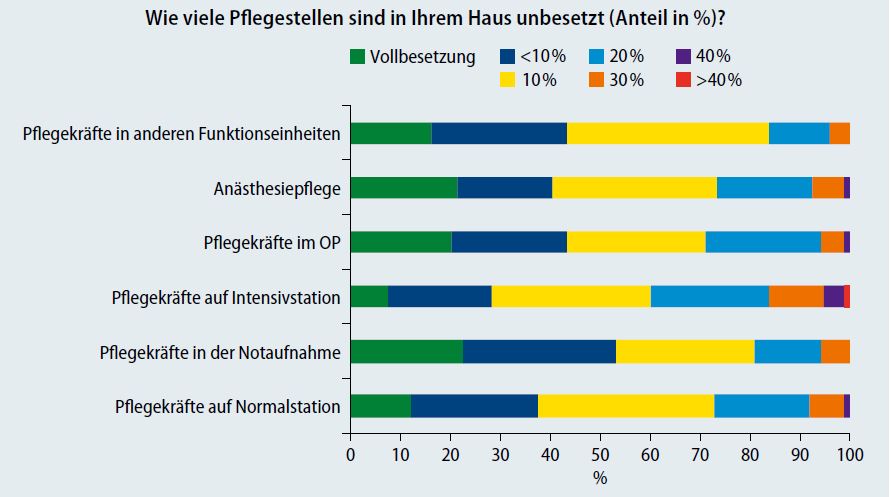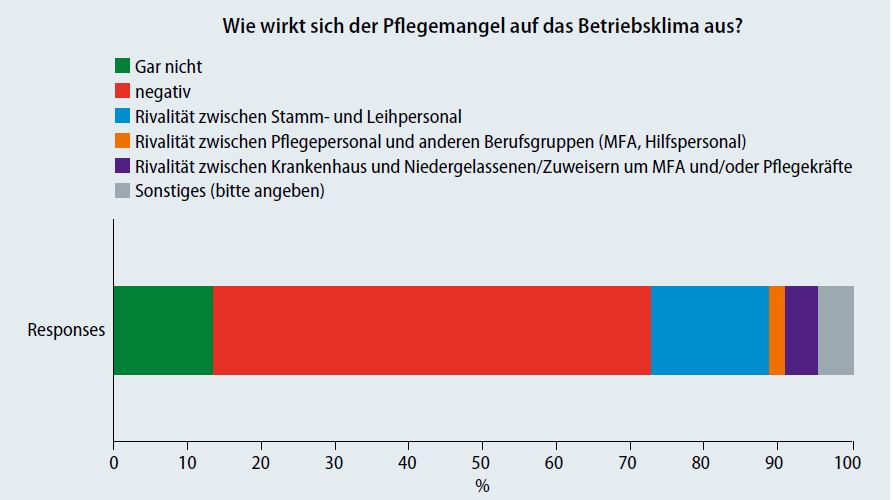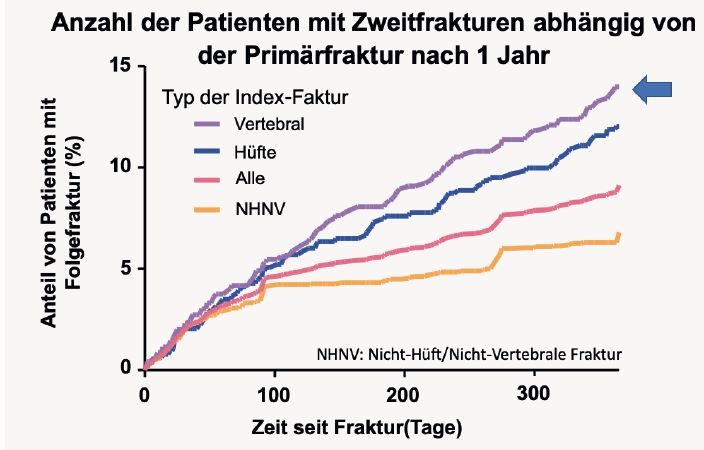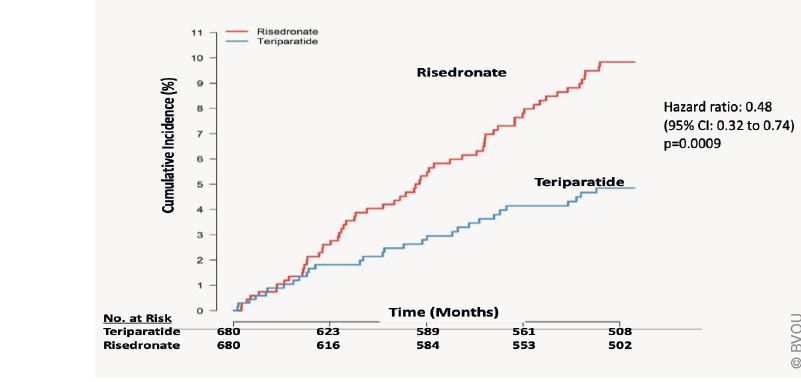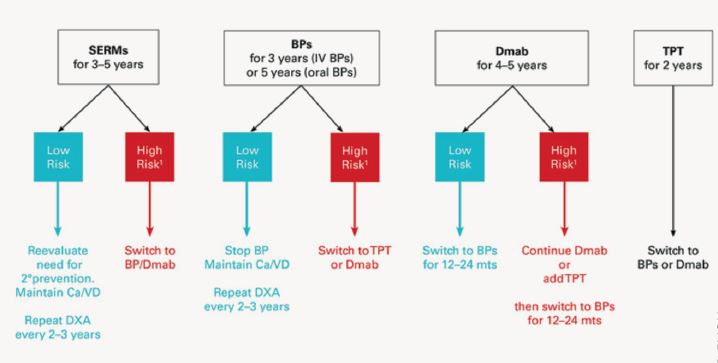Berg am Starnberger See – Dr. Siegfried Götte (ehem. BVOU-Präsident) spricht über persönliche Ansprüche und Ziele zu seiner Amtszeit:
In 12 Jahren verantwortlicher Stellung des BVO/BVOU als 2. bzw. 1. Vorsitzender respektive Präsident galten für mich folgende persönliche Ansprüche und Ziele in Abstimmung mit dem Geschäftsführenden Vorstand:
Berufsverband aller Orthopäden bzw. Orthopäden und Unfallchirurgen, Leistungsstärke und Professionalität des Verbands, kompetente Fortbildung und zertifizierte Versorgungsqualität, Begegnung auf Augenhöhe mit den wissenschaftlichen Gesellschaften DGOOC, DGU und DGOU, dem Schulterschluss aller Orthopäden, respektive Orthopäden und Unfallchirurgen, gemeinsame Strategien nach dem Motto: gemeinsam stärker, Verteidigung orthopädischer Leistungsinhalte, Unterstützung der Orthopädischen bzw. Orthopädisch-Unfallchirurgischen Praxis in Fragen von Versorgungsqualität und Vergütung.
Bereits in den Jahren 1987-1994 als Bezirksobmann des BVO in München galt mein Interesse der Fortbildung und berufsrelevanten Informationen der niedergelassenen Kollegen mit monatlichen Veranstaltungen und halbjährlich vorgegebenem Programm sowie aktuellen berufspolitischen Informationen aus der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und der Bayerischen Landesärztekammer.
Das Thema Fortbildung als eine der vordringlichen Aufgaben des BVO unter Dr. Georg Holfelder, hat mich in den Jahren als Schriftführer des BVO-Vorstands in nahezu zwei Vorstandsperioden beschäftigt. Hieraus resultierte meine Vertretung des BVO in der damaligen Programmkommission mit der DGOT/DGOOC sowie den Vertretern der Vereinigungen der Nord- und Süddeutschen Orthopäden zur Abstimmung der jeweils jährlichen Themengewichtungen der Kongresse.
Aus dieser Tätigkeit resultierte die Vision eines dringend notwendigen, engen Schulterschlusses im Sinn einer Corporate Identity und gemeinsamer Stärkung unseres Fachs; also aller Orthopäden in Klinik und Praxis in gegenseitigem Respekt und Wertschätzung sowie ein intensives Zusammenwirken von Berufsverband und Wissenschaftlicher Gesellschaft auf Augenhöhe. Dieses Primat war in den Folgejahren nach dem Ausscheiden von Dr. Friedhelm Heber 1999 nach meinem Verständnis insbesondere auch dem neuen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie unter Berücksichtigung aller daraus resultierenden Versorgungsaspekte geschuldet.
Vor dem Hintergrund dieser Ziele und den damit verbundenen Anforderungen an eine weitere Leistungssteigerung des Verbands ergab sich konsequenterweise die gegenseitige Vertretung in den Vorständen durch den 1. Vorsitzenden ,respektive später des Präsidenten des BVO/BVOU in der wissenschaftlichen Gesellschaft und des Generalsekretärs der DGOOC mit zunächst Prof. Lutz Jani (†) und in seiner Nachfolge
Prof. Fritz Niethard im Berufsverband und der Berücksichtigung dieses Prinzips mit entsprechenden personellen Erweiterungen in den nachfolgend geänderten Strukturen.
Die Anstellung eines Geschäftsführers im BVO 1998 ist als erster Schritt zur stärkeren Professionalisierung zu sehen, wie auch die 2000 nachfolgende Verlegung der Geschäftsstelle nach Berlin, in die Mitte des politischen Geschehens nach dem Umzug der Bundesregierung, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer sowie übriger bedeutungsvoller gesundheitspolitisch aktiver Verbände in die Hauptstadt.
Der Deutsche Orthopäden Kongresses wurde ab 2001 nach Berlin verlegt und wenige Jahre später die Geschäftsstelle der DGOOC, während die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) bereits ihren langjährigen Sitz im Langenbeck-Virchow-Haus in der Luisenstraße 106-108, 10623 Berlin hatte. Unterdessen haben BVOU und DGOU ihre Geschäftsstellen in der Straße des 17. Juni in 10623 Berlin.
Der Wechsel in die Hauptstadt in die Nähe der gesundheitspolitischen Entscheidungsträger hatte eindeutig zur Folge, das Ansehen und die Leistungsfähigkeit des BVO/BVOU intern und extern gegenüber den ärztlichen Körperschaften, der Politik, anderen Fachgebieten in der interdisziplinären Herausforderung sowie der Öffentlichkeit zu stärken.
Eine Verbesserung der Kommunikation des Vorstands mit den Verbandsmitgliedern und die Darstellung des Verbands gegenüber orthopädischen Nichtmitgliedern erfolgte bereits auf dem etablierten Deutschen Orthopädenkongress in Wiesbaden als Gemeinschaftskongress von BVO und DGOOC mit eigenem Informationsstand und einer gesetzten berufspolitischen Informationsveranstaltung.
Ab 1999 gelang es dankenswerter Weise beide Einrichtungen auch auf dem Jahreskongress der Vereinigung der Süddeutschen Orthopäden zu etablieren.
Mit dem Ziel einer direkten und verbesserten Kommunikation mit den Leitern der Orthopädischen Kliniken und Abteilungen war der BVO/BVOU seit 2001 auf der Jahrestagung dem Verein der Leitenden Orthopäden, VLO und später VLOU vertreten.
Flankierend hinzu kam die Überarbeitung der Orthopädischen Mitteilungen und Nachrichten als gemeinsames Informationsmedium mit der DGOOC, sowie später mit der DGU, dem der Ausbau weiterer gemeinsamer Strukturen folgte.
Im Zug der Verlegung der Geschäftsstelle nach Berlin wurde der erste Internetauftritt des Verbands, das BVO.net, etabliert. Unter diesem Dach fand auch die Akademie Deutscher Orthopäden (ADO) seit ihrer Gründung 2001 einen festen Platz mit ihrem Veranstaltungsangebot als Antwort auf die durch die Bundesärztekammer eingeführte Zertifizierte Fortbildung und dem Bestreben kontinuierlich aktualisierter Fortbildungsinhalte durch den BVO in Zusammenarbeit mit der DGOOC. Fast zeitgleich mit der Zertifizierten Fortbildung gilt es die vom BVO initiierte Zertifizierung der Orthopädischen bzw. Orthopädisch-Unfallchirurgischen Praxis nach DIN ISO 2000 mit einem Musterhandbuch zu nennen und als schrittweise Variante das BVO/BVOU-Cert.
Mit der Verlegung der Geschäftsstelle nach Berlin in die Mitte des medizinpolitischen Geschehens und ihrer Leistungssteigerung konnten sowohl die Vorstandsarbeit sowie die Unterstützung der Landes- und Bezirksvorsitzenden intensiviert und die Schlagkraft des Berufsverbands verbunden mit einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit auch die Verbindung zu Patientenverbänden mit den Themen Osteoporose und Rheumatologie sowie der Amputierten-Hilfe u.a. zusätzlich verbessert und erweitert werden.
Dem Anliegen der verbandsinternen Kommunikation diente ferner der auf Ende Januar festgelegte Orthopäden-Tag, der Versammlung von Vorstand, Landes- und Bezirks-vorsitzenden zum internen Erfahrungsaustausch unter der Berücksichtigung aktueller berufspolitischer Themen, begleitet von Auftakt-Referaten zu fachrelevanten Fragen mit entsprechenden Gästen. Bereits 1998, noch in der Geschäftsstelle in Neu-Ulm, wurde die Auflage der Patientenzeitschrift Orthinform verwirklicht, mit dem gleichnamigen Auftritt im späteren BVO.net, ebenso der Infobrief, als zeitnahe, kurzzeitige Information der Mitgliedern des BVO in Ergänzung der Mitteilungen und Nachrichten.
Als nachhaltiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit sind auch die mit der DGOOC und dem BV-Med gemeinsam durchgeführten PR-Kampagnen Anfang der 2000er Jahre sowie die aktive Teilnahme und Unterstützung der Bone and Joint Decade zu werten.
Der Anspruch an die berufspolitische Vertretung aller Orthopäden und Unfallchirurgen bestand und besteht, abgesehen von Fort- und Weiterbildung als ganz besondere Verpflichtung des BVO/BVOU, in der Unterstützung und Stärkung des Ansehens unserer Berufsgruppe, vordringlich aber auch die Fragen zur Wirtschaftlichkeit der Orthopädischen bzw. Orthopädisch-Unfallchirurgischen Praxis als kleinste Leistungseinheit unseres Fachs in existentiellerer Eigenverantwortung und in ihrer großen Bedeutung für eine fachspezifisch kompetente wohnortnahe Versorgung muskuloskelettaler Fehlbildungen, Erkrankungen und Verletzungen.
Um diesem Anspruch auch zukünftig unter dem Aspekt der sich ändernden Versorgungslandschaft und der gefühlten Drohung einer Primärärztlichen Versorgung begegnen zu können, erfolgte auf Vorschlag der jüngeren Vorstandsmitglieder 1996 die erste Umfrage des BVO bundesweit unter den Praxen der Verbandsmitglieder zu unterschiedlichen Praxisstrukturen, d.h. Einzel-, Doppel- und Mehrfachpraxen, den Leistungsspektren konservativ und operativ, dem Ambulanten Operieren, der Belegarzttätigkeit, OP-Einrichtungen in der Praxis und extern sowie apparative Ausstattungen, z.B. Röntgen, Sonografie und Osteodensitometrie, wie auch den stark vertretenen Physikalisch-Physiotherapeutischen Abteilungen in den Praxen. Dieser ersten Erhebung folgten weitere versorgungsrelevante Analysen, zum Teil mit vergleichenden Erhebungen aus den Kassenärztlichen Vereinigungen, Ärztekammern und Kassen zur Transparenz der Leistungsstärke und des Spektrums der orthopädisch-en und unfallchirurgischen Versorgung in der Rechtfertigung von Existenz- und Honoraransprüchen unter dem Aspekt einer kompetenz- und qualitätsgestützten Versorgung nach dem Motto: ‚Pay for Performance’.
Mit einer professionellen Geschäftsstelle waren weitere Studien der sich zunehmend ändernden orthopädischen und unfallchirurgischen Versorgungslandschaft auch unter betriebswirtschaftlichen Aspekten möglich, teilweise auch mit anderen Organfachärztlichen Berufsverbänden zur Frage der wohnortnahen fachärztlichen Versorgung. Durch derartige Studien gewann das Thema Versorgungsforschung einen besonderen Stellenwert und führte zu einer engen Zusammenarbeit mit dem Deutschen Netzwerk Versorgungsforschung, der Teilnahme an dessen Kongressen und der Vertretung des BVO/BVOU durch Prof. Karsten Dreinhöfer im Vorstand des Netzwerks.
Mit dem Thema Versorgungsforschung verbindet sich konsequenter Weise die Frage von Versorgungsdefiziten im Sinn von Unter-, Über- und Fehlversorgung sowie inadäquaten , verbesserungsbedürftigen Kostenstrukturen.
In der logischen Konsequenz resultiert hieraus das fachliche Engagement für eine bessere Versorgung unter Berücksichtigung der Versorgungsschwerpunkte eines Fachs oder seiner Weiterentwicklungen und Qualifikationen insbesondere auch für eine Verbesserung der Honorarsituation.
Im Gegensatz zu unserer Überzeugung schien es Vertretern Kassenärztlicher Vereinigungen und Ansprechpartnern von Krankenkassen bisweilen schwer zu fallen, die Versorgungskompetenz unseres Fachs in seiner Breite und Vielfalt allein durch die Erfassung von Abrechnungsziffern und Diagnosen bzw. ICD-Ziffern zu erfassen und ein für sie klares Profil der Versorgungsqualität des orthopädisch-unfallchirurgischen Leistungsspektrums zu erkennen.
Dieser Bezug galt insbesondere der Konservativen Orthopädie als Versorgungsschwerpunkt der Orthopädischen Praxis im Konkurrenzfeld mit der Allgemeinmedizin, der hausärztlichen Inneren Medizin, der Physikalischen und Rehabilitativen Medizin und der Rheumatologie. – Für die allgemeinen Erklärung und das Verständnis der Konservativen Orthopädie wurde im BVO Mitte der 2000er-Jahre eine Arbeitsgruppe für die Erstellung eines Weißbuchs eingesetzt.
Eine besondere Herausforderung in ihrer interdisziplinäre Anerkennung, ähnlich der Konservativen Orthopädie und abgesehen von den Operationen mit rheumatologischer Indikation, galt der Orthopädische Rheumatologie und ihrer im Vergleich mit den Internistischen Rheumatologen nicht zu verkennenden, umfassenden Versorgungsqualität in der Praxis. Diesbezüglich haben sich die Kollegen Dr. Martin Talke (✝) und Dr. Uwe Schwokowski besonders verdient gemacht und die Anliegen des BVO/BVOU sehr unterstützt, während Schwerpunkte wie die Osteologie in Kooperation mit der Orthopädischen Gesellschaft für Osteologie (OGO) und die Schmerztherapie mit der Interdisziplinären Gesellschaft für orthopädische/ unfallchirurgische und allgemeine Schmerztherapie (IGOST) in sehr guter Kooperation vertreten wurden.
Die Interessensvertretung der Belegärzte im Verband wurde von Dr. Peter Heppt verantwortet, das Thema Kernspintomographie im Fach von Dr. Axel Goldmann.
Im Rahmen der Versorgungsforschung und Leitliniengestaltung konnte zum Thema Rückenschmerz nach einer Initiative der Bertelsmann-Stiftung durch Intervention des BVOU die Beteiligung von BVOU, IGOST und der Sektion Physikalische Therapie und Rehabilitation der DGOOC erwirkt werden. In dieser, ursprünglich mit Anästhesisten, Psycho- und Physiotherapeuten sowie Versorgungsforschern besetzten Arbeitsgruppe, wurden die Leitlinie Rückenschmerz und der ‚Gesundheitspfad Rücken’ zur interdisziplinären Orientierung erarbeitet. An der interdisziplinären Entwicklung der Leitlinie Osteoporose des Dachverbands Osteologie (DVO) war der BVOU durch Dr. Hermann Schwarz und Dr. Peter Clarenz vertreten , auf internationaler Ebene in der IFO (International Foundation of Osteoporosis) durch Prof. Karsten Dreinhöfer.
Die ebenfalls traditionelle und für zukünftige Entwicklungen der Gesundheitspolitik auf europäischer Ebene berufspolitische Vertretung in der UEMS erfolgte durch Dr. Günter Abt und Prof. Joachim Grifka.
Eine weitere Vertretung im europäischen Umfeld konnte durch die Mitgliedschaft des BVOU in der EFORT erreicht werden mit eigenen berufspolitischen Sitzung auf dem jährlichen EFORT-Kongress und Blick auf eventuell zukünftige innereuropäische Harmonisierungen der fachbezogenen Strukturen unter Berücksichtigung der Versorgungsqualität und des wohnortnahen Versorgungsspektrums durch die Praxis sowie der besonderen Wertigkeit der Konservativen Orthopädie.
Aus diesem Strauß berufspolitischer Aktivitäten konnte in Ergänzung des Leitbilds für Orthopädie und Unfallchirurgie 2009 ‚Unser Auftrag’ formuliert werden:
Der BVOU setzt die beruflichen Interessen seiner Mitglieder durch, indem er zum Vorteil der Patienten und des Gemeinwohls
- gemeinsam mit den wissenschaftlichen Gesellschaften den Standard orthopädisch-unfallchirurgischer Versorgung entwickelt,
- die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen prägt und dadurch
- die öffentliche Wahrnehmung seiner Mitglieder als Experten für orthopädisch-unfallchirurgische Versorgung gestaltet.
Dem Engagement des BVOU in der Bundesärztekammer, in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und in den Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder sowie in den Landesärztekammern ist es zu verdanken, dass zentrale Fragestellungen von Fort- und Weiterbildung, der kassenärztlichen und privaten Gebührenordnung sowie der Berufsgenossenschaft im Interesse von Orthopäden und Unfallchirurgen Eingang in die Gesundheitspolitik gefunden haben und weiterhin finden werden.
Retrospektiv konnte der BVO/BVOU über seine bestehende historische Anerkenntnis hinaus in den Jahren 1999 – 2009 als solide Basis für viele zukünftige berufspolitischen Aufgaben gerüstet werden. Die historisch höchste Mitgliederzahl dürfte Ausdruck des errungenen Ansehens und seiner Leistungsfähigkeit sein.
Ohne die tatkräftige Unterstützung der BVO und BVOU-Mitglieder wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen.
Allen Unterstützern über die persönlich benannten hinaus, gilt auch hier mein persönlicher, herzlicher Dank!
Dr. Siegfried Götte, Berg am Starnberger See
-
1989 – 1997: Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands des BVO unter Dr. Georg Holfelder.
-
1999 – 2001: 2. Vorsitzender unter Dr. Friedhelm Heber und nach dessen Rücktritt
-
bis 2001: stellv. 1. Vorsitzender.
-
2001 bis 2009: 1. Vorsitzender bzw. Präsident des BVO.
-
2001 – 2009: Vorsitzender der Stiftung Akademie Deutscher Orthopäden (ADO)