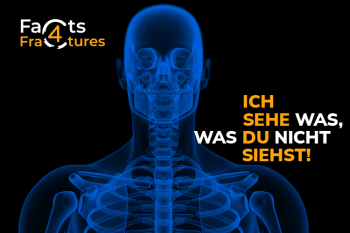Berlin/Kassel – Der Landesvorsitzende des BVOU in Hessen, Dr. Gerd Rauch, Prof. Werner Siebert und Prof. Joachim Windolf sind das Präsidententeam für den diesjährigen Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU), der vom 23. bis 26. Oktober in Berlin stattfindet. Im Interview erläutert Rauch, welche Themen ihm besonders wichtig sind, wofür er seinem Vorgänger Prof. Alexander Beck dankbar ist und weshalb der DKOU für alle Kolleginnen und Kollegen ein reizvoller Kongress ist.
Herr Dr. Rauch, Sie sind der DKOU-Präsident des BVOU in diesem Jahr. Worüber und worauf freuen Sie sich am meisten?
Dr. Gerd Rauch: Ich komme ja aus einer sehr großen, operativ wie konservativ tätigen orthopädisch-unfallchirurgischen Praxis und habe im Lauf meines Berufslebens viel Routine entwickelt. Die DKOU-Präsidentschaft stellt nun eine Zäsur da, die mich aus dieser Routine natürlich herausholt. Interessant und herausfordernd finde ich, mich wieder mit der ganzen Bandbreite unseres Fachs O und U sowohl wissenschaftlich wie berufspolitisch zu befassen.
Was verbinden Sie mit dem Kongressmotto 2018 „Wir sind O und U“?
Rauch: Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie gibt es nun seit zehn Jahren, der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie ist lange umbenannt. „Wir sind O und U“ beschreibt gut, dass die früheren Fachgebiete inzwischen doch sehr eng zusammengewachsen sind. Wir drei DKOU-Präsidenten fanden, dass es an der Zeit ist, die Gemeinsamkeiten von O und U zu betonen und alle Facetten des großen Faches darzustellen. Deshalb haben wir uns für das Motto „Wir sind O und U“ entschieden und beim Logo 2018 für viele Mosaiksteine.
Welche Themenaspekte sind Ihnen besonders wichtig?
Rauch: Das ist schwer zu sagen, weil so vieles relevant ist. Eines der Hauptthemen, Digitalisierung in O und U, halte ich persönlich für sehr zukunftsträchtig, schwer vorhersehbar und extrem wichtig für uns alle. Da geht sehr vieles mit ein, von hilfreichen Apps über künstliche Intelligenz bis hin zur Überwachung ärztlicher Leistung. Meiner Meinung nach müssen wir versuchen, die Chancen der Digitalisierung für O und U zu nutzen und gleichzeitig das vertrauensvolle Arzt-Patient-Verhältnis zu schützen.
Was die berufspolitischen Themen anbelangt, so wird das Thema Feminisierung eine Rolle spielen. Die Medizin wird weiblich, auch die Orthopädie und Unfallchirurgie. Wir können Medizinstudentinnen und junge Ärztinnen für unser Fach begeistern, das zeigen verschiedene Veranstaltungen für den Nachwuchs. Aber wir müssen schon auf sie zugehen und schauen, welche Arbeitsbedingungen für die jungen Kolleginnen und ebenso die jungen Kollegen in Praxis und Klinik geboten werden müssen.
Berufspolitische Themen gehen manchmal angesichts der Fülle des Kongressangebots etwas unter. Aber sie sind wichtig. Ob Nachfolgeprobleme in Praxen und Krankenhäusern in ländlichen Gegenden, ob Ökonomisierung und dadurch Entmachtung der Medizin – hierüber müssen wir diskutieren und uns als O und U gemeinsam positionieren. Wichtig ist dabei, die Probleme aller Kollegen aufzugreifen und ernst zu nehmen, ob sie nun in einer konservativ ausgerichteten Einzelpraxis tätig sind oder in einem großen Haus operieren.
Wir sind im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung ein wichtiges Fach. Wir müssen unsere berufspolitischen Interessen, die wir zum Wohl der Patienten vertreten, noch stärker betonen. Wir als BVOU treten deshalb dafür ein, dass orthopädisch-unfallchirurgische Leistungen in der Gesellschaft wieder höher geschätzt werden. Die längst überfällige Entbudgetierung der ärztlichen Leistungen in den Praxen und die neue Implementierung von fachärztlichen Selektivverträgen sind wichtige berufspolitische Forderungen, für die wir uns einsetzen müssen.
Während des DKOU laufen sehr viele Veranstaltungen parallel. Ist das unabänderlich?
Rauch: Das ist bei jedem Großkongress ein Problem, aber eines, das schwer zu lösen ist. Daran zeigt sich eben, wie umfangreich die Themen unseres Fachs mittlerweile sind, die längst auch Aspekte wie Schmerztherapie bis zur Schwerstverletztenversorgung bei Massenunfällen umfassen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Es muss und soll dabei bleiben, dass der DKOU bei der Pluralität des großen Fachgebietes eine Vielzahl von Veranstaltungen bietet. Für das Kongressfinale haben wir aber eine Änderung umgesetzt, damit alle daran teilnehmen können: Alle Sitzungen enden schon am Freitag um 17 Uhr, danach folgt das Kongressfinale um 17.15 Uhr.
Gibt es etwas, dass Sie anders machen wollen als das Team 2017?
Rauch: In vielem müssen wir das Rad nicht neu erfinden, weil die Abläufe und Gewichtungen sehr gut waren. Auffällig war beim DKOU 2017, dass die O und U-Basics-Sitzungen des Fachs mit klarer Strukturierung gerade von jüngeren Kolleginnen und Kollegen sehr gut besucht waren und die Räume überfüllt. Hierfür werden wir in diesem Jahr wesentlich größere Sitzungssäle einplanen. Für erfahrenere Kolleginnen und Kollegen braucht es vertiefende, separate Angebote, die in allen Facetten des Faches angeboten werden. Wir werden außerdem darauf achten, dass D-Ärzte ihre ganz normale Pflichtfortbildung auch während des DKOU absolvieren können und dass genügend Reha-Themen im Programm zu finden sind.
Außerdem wollen wir große Sektionen noch stärker als bisher einbinden. Am Mittwoch wird die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft einen ganzen Tag ihr eigenes Programm gestalten, am Donnerstag die Deutsche Handgesellschaft und am Freitag die Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie. Im großen Saal, der den genannten Gastgesellschaften dann zur Verfügung steht, wird es fürs internationale Publikum wahrscheinlich englische Simultanübersetzungen geben. Auch das DKOU-Gastland Großbritannien wird jeweils hochkarätige Referenten entsenden.
Der DKOU hat traditionell drei Kongresspräsidenten. Welche Herausforderungen ergeben sich dadurch? Was ist im Zusammenspiel besonders wichtig?
Rauch: Die Zusammenarbeit mit den Kollegen Prof. Werner Siebert und Prof. Joachim Windolf klappt hervorragend. Ich finde, wir agieren als Team, wie in einer Mannschaft. Wir haben vereinbart, dass wir uns eng austauschen, ganz besonders wenn es darum geht, bestimmte Konzepte oder Positionen nach außen hin zu vertreten. Mit Intercongress haben wir einen sehr erfahrenen, engagierten Veranstalter, so dass bislang alles sehr gut läuft. Auch unterstützen uns unsere Ehefrauen, die Orga-Teams und viele fleißige unbenannte Helfer vortrefflich.
Was muss man mitbringen, wenn man für den BVOU DKOU-Kongresspräsident ist?
Rauch: Auf jeden Fall sehr viel Engagement, gepaart mit Durchhaltevermögen und Teamgeist, also Fähigkeiten, die wir auch in Praxis und Klinik haben müssen. Jeder Kongresspräsident sollte auch Perspektiven aufzeigen, wie man das eigene Fach zukunftsfest machen kann, wie man den Nachwuchs weiter dafür begeistert, wie man sich in die internationale Entwicklung von O und U einbindet. Dafür muss man Zeit mitbringen und sich mit einzelnen Themen intensiv befassen.
Mit welchen Hinweisen würden Sie Kolleginnen und Kollegen, die nie zum DKOU fahren, für den nächsten Kongress begeistern?
Rauch: Das umfangreiche Programm bietet wirklich für jeden etwas. Neben der Vielzahl medizinischer Themen umfasst der DKOU auch zahlreiche berufspolitische und betriebswirtschaftliche Angebote, und zwar in einer Form, von der man ganz praktisch profitieren kann. Hinzu kommt, dass wieder ein besonderer Schwerpunkt auf den Spitzen- und Breitensport gelegt wird mit dem Thema der Funktion der Mannschafts- und Verbandsärzte sowie dem zentralen Problem im Profisport – dem Thema Muskel. Ich betreue ja eine Handballmannschaft der ersten Bundesliga, die MT-Melsungen, und viele weitere Mannschaften in mehreren Sportarten und habe deshalb ein besonderes Faible für diesen Themenbereich.
Haben Sie sich etwas von Ihrem Vorgänger Prof. Beck abgeguckt?
Rauch: Ich bin ihm dankbar dafür, dass er so offen und ehrlich über seine Kongresserfahrungen 2017 gesprochen hat. Ebenso haben seine Vorgänger mir viele Tipps gegeben. Aber es gilt natürlich: Jeder Kongresspräsident, jedes DKOU-Team muss seinen eigenen Stil finden und als Team zusammenwachsen. Ich will versuchen, die BVOU-Landesvorsitzenden und den BVOU-Vorstand etwas stärker in die Programmgestaltung und in Vorträge einzubinden. Sie sind nah an der Basis und haben ein gutes Gespür dafür, was den Kolleginnen und Kollegen wichtig ist. Zudem planen wir als Bewegungsexperten einen Sportparcours in der Eingangshalle.
Was ist bei der Vorbereitung für den DKOU 2018 die größte Herausforderung?
Rauch: Das Zeitmanagement neben der großen Praxis und das Bemühen, die Themen herauszuarbeiten, die viele interessieren und deren Aufarbeitung uns weiterbringt.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Sabine Rieser.